„Wenn wir das halten können, haben wir eine Chance!!“.
Aber wie sollen wir das halten können? Zu zweit sind wir auf einer der wenigen kurzen Passagen in der Rheinebene die eher nordwärts laufen; das bedeutet massiven Rückenwind für uns. Die meiste Zeit aber kurbeln wir in Schräglage im erbarmungslos blasenden Südwind, der „Hintermann“ so gut wie gleichauf, um wenigsten etwas vom Windschatten zu profitieren. Eine kleine Wendung und wir stehen wieder voll drin. Wie sollten wir das halten können, noch weit über zwei Stunden lang. Wir sind am Limit. Jetzt schon, immer noch, schon seit Stunden.
 Endgültig versemmelt haben wir die Geschichte wohl heute früh, beim nächtlichen Frühstück im zweiten Hotel. Nun es gab kein Hotelfrühstück um 3:45 Uhr mitten in der Nacht vor dem Aufstehen, aber Frühstück im Hotel. Aus unerfindlichen Gründen war das Wasser abgestellt, was nicht nur fatale Folgen für die WC-Spülung hatte. Noch nicht mal Wasser hatten wir was angesichts der Tageszeit und eines gewissen desolaten Körperzustands kaum mehr ins Gewicht viel.
Endgültig versemmelt haben wir die Geschichte wohl heute früh, beim nächtlichen Frühstück im zweiten Hotel. Nun es gab kein Hotelfrühstück um 3:45 Uhr mitten in der Nacht vor dem Aufstehen, aber Frühstück im Hotel. Aus unerfindlichen Gründen war das Wasser abgestellt, was nicht nur fatale Folgen für die WC-Spülung hatte. Noch nicht mal Wasser hatten wir was angesichts der Tageszeit und eines gewissen desolaten Körperzustands kaum mehr ins Gewicht viel.
Das Frühstück im ersten Hotel war da schon besser gewesen, aber weggekommen sind wir dort dafür erst um 09:30. Oder doch schon? Denn eingecheckt hatten wir keine 5 Stunden vorher. Vielleicht hatten wir es schon dort vergeigt – ohne es zu ahnen.
Heute saßen wir jedenfalls schon um 05:00 auf den Rädern; zu früh(!) und doch zu spät
Dieser Scheiß Wind. Das schaffen wir nicht, das können wir nicht schaffen. Wer nicht kämpft hat schon verloren. Wenn wir auf der Rheinbrücke noch eine Stunde haben, haben wir eine reelle Chance. Auf der Rheinbrücke, eine Stunde.
 Vor zwei Tagen, am 22.05.14 waren wir Beide gestartet, bei gutem Wetter und guten Mutes. Um 07:33 ging es am Martinstor, unserem späteren Ziel, los.
Vor zwei Tagen, am 22.05.14 waren wir Beide gestartet, bei gutem Wetter und guten Mutes. Um 07:33 ging es am Martinstor, unserem späteren Ziel, los.
54 Stunden blieben uns, um bis spätestens 13:33 wieder in Freiburg zu sein, wollten wir unsere Namen in die geheiligte, ewige Liste der Super-Randonnées als Randonneure eintragen lassen.
Nach allen Hochrechnungen erschien die Strecke in rund 40h machbar zu sein, wenn alles gut geht.
Im Schweizer Jura nach 130 km und mehr als 7 ½ Stunden auf dem Rad dachte ich wir kämen da nie mehr raus. Denke niemals „nie“… Knapp 1 ½ Stunden später waren wir dann immerhin schon 10 km weiter – das Ergebnis konzentrierten, pausenlosen Tretens in fraktal anmutenden Landschaften. Da lachte ich herzhaft und meinte, dass wir noch nicht mal schlecht in der Zeit wären, alles im grünen Bereich. Bei mir weckte das üble Erinnerungen an die „Grüne Hölle“ am Ring – nur dass es hier noch grüner und steiler war. Ein genialer, ein schöner Tag in Klein-Rampistan, Gegenanstieg auf Gegenanstieg, Berg an Berg, Rampe an Rampe; Temperatur und Harmonie perfekt, Maximalgeschwindigkeit immer wieder um die 70, Nettoschnitt so um die 16 km/h. Alles war gut.
Ein genialer, ein schöner Tag in Klein-Rampistan, Gegenanstieg auf Gegenanstieg, Berg an Berg, Rampe an Rampe; Temperatur und Harmonie perfekt, Maximalgeschwindigkeit immer wieder um die 70, Nettoschnitt so um die 16 km/h. Alles war gut.
Nachts um 00:42 nach über 17 Stunden im Sattel, Kilometer 234 auf dem Chasseral, auf 1600 Metern im strömendem Regen, da lachte niemand mehr. Die eisigen, nassen Klamotten klebten auf der Haut und der Wind schien direkt durch alle Schichten zu blasen. Die Abfahrt gab uns den letzten Rest. In St. Imier suchten wir nur noch eins: Ein Hotel. Ein offenes Hotel nachts nach 01:00, St. Imier, weit über fünftausend Einwohner. Vergiss es. Schlotternd und bibbernd zogen wir durch einsame, menschenleere Häuserschluchten und standen vor verschlossenen Türen. Noch nicht mal eine Döner-Bude hatte noch auf. Wir mussten weiterfahren um nicht direkt zu erfrieren. Rauf auf den nächsten nächtlichen Berg. Nomen est nicht Omen: Mont Soleil. Rauf war gut. Meine Beine wollten nicht mehr so recht, der Kopf war leer; nur der Tank leerer. Die nächste Abfahrt, schlimmer als jeder Aufstieg – Kälte, Nässe, Hunger; eine endlose Nacht vor uns, in Erwartung vorhergesagten Dauerregens für den ganzen kommenden Tag. 
Irgendwo nach queren einer schluchtig tief ausgegrabenen Baustelle suchten wir Schutz in einem Hauseingang. Essen, wir mussten Essen. Ganz schön schwer, wenn der ganze Körper zittert und die Zähne vor lauter Klappern nicht mehr kräftig zubeißen können. Immer stärkerer Regen im gelben Licht einer Strassenlaterne. Le Breuleux, ein Kaff. Eine Auberge. Mitten in der Nacht um 03:30. Ja klar doch, keine Frage, da sitzt die Wirtin in der Wärme an der Theke und pichelt noch ein Weinchen mit ihrer Busenfreundin. Gesehen habe ich das wie eine Offenbarung schemenhaft durch ein beschlagenes Fenster und verregnete Brillengläser. Und das nur, weil ich vor Kälte und Zittern nicht mehr stehen konnte und ein paar Schritte im strömenden Regen ein bisschen im Ort ziellos um die Ecke spazierte. „Les Almands sont fous“. Statt in die Doubs-Schlucht fielen wir in warme Daunenbetten.
Träumen wir, noch? Die Sonne strahlt.  Ein Tag. Vor der Tür, vor uns, ein Traumtag. Warm und wolkenlos und blau, so blau blau blaublaublau. Um 09:30 erst saßen wir wieder auf den Rädern weil uns keine Gewalt der Welt hätte vorher aus den Betten reißen können und wir uns dann nicht in der Lage sahen, das Frühstück vor dem zweiten, dritten Kaffee zu beenden. Was waren das auch für ausnehmend freundliche Damen – drei an der Zahl – für das Frühstück kam die Ablösung. Und noch ein Croissant und ein Döschen Konfitüre extra und noch ein Lächeln obendrein. Und noch ein Croissant? Ach was war das Leben schön.
Ein Tag. Vor der Tür, vor uns, ein Traumtag. Warm und wolkenlos und blau, so blau blau blaublaublau. Um 09:30 erst saßen wir wieder auf den Rädern weil uns keine Gewalt der Welt hätte vorher aus den Betten reißen können und wir uns dann nicht in der Lage sahen, das Frühstück vor dem zweiten, dritten Kaffee zu beenden. Was waren das auch für ausnehmend freundliche Damen – drei an der Zahl – für das Frühstück kam die Ablösung. Und noch ein Croissant und ein Döschen Konfitüre extra und noch ein Lächeln obendrein. Und noch ein Croissant? Ach was war das Leben schön.
Bei der Abfahrt in die Doubs-Schlucht geriet ich fast außer mir vor Begeisterung und das Herzrasen kam dann noch im folgenden Gegenanstieg dazu. Pittoreske Strassenbaukunst aus einer Zeit in der es für Ochsen noch keine Begrenzung der Steigungsprozente gab. La Goule grub sich noch tiefer in die Erinnerung ein als der Doubs in den weichen Kalkstein. Auf der anderen Seite wieder auf dem Hochplateau, liebliche Landschaften mit sanften Hügeln. Jeder Traum hat ein Ende.
Radeln, Essen, Sonnencreme. Flachstücke, Cafés, kurze Röcke. La vie claire. Ballon de Servance, der erste Belchen in den Vogesen und Schwupp die Wupp war es 20:00 und wir oben auf dem Ballon d´Alsace. Zwei Tage rum und 451 km waren geschafft. Die Abendsonne färbte den Himmel und die dräuenden Gewitterwolken lilagrauschwarzrot.
Die letzte Nacht hatte mich weich gemacht und ich suchte nach Argumenten, Bernhard eine weitere Hotelübernachtung schmackhaft zu machen. Ich wollte nicht noch einmal so eine Nacht. Nicht noch einmal so eine Nacht.
Warum nimmt die Rheinebene kein Ende? Der Wind, der Wind. Eineinhalb Stunden. Minuten sind unendlich lang, neunzig Kurbelumdrehungen in dieser kleinen Ewigkeit, jede Einzelne tut weh und doch schmilzt die Zeit wie Schnee in der kräftigen Augustsonne. Ich sehne mich nach der Dose Cola, die ich noch in der Packtasche gebunkert habe. So unerreichbar weit weg. Ich trau mich nicht, sie rauszuholen, der Zeitverlust ist in keinster Weise vertretbar. Noch nicht. Vielleicht auf der Rheinbrücke, wenn wir da noch eine Stunde haben. Rheinbrücke, Rheinbrücke. Treten, Treten, Rheinbrücke, Rheinbrücke. Treten. Die Zeit rast und vergeht unendlich langsam.
G estern Abend, kaum ausgeredet, da kam argumentative Unterstützung von oben. Donnergrollen im Rücken, erste Riesentropfen schlugen auf Helme, Arme und Oberschenkel. Das war sehr überzeugend für Bernhard, ich musste überhaupt nicht weiter in ihn dringen. Flucht in die Ferme 200 Meter weiter – aber kein freies Zimmer mehr. Dreihundert Meter weiter ein Hotel – geschlossen. Die Wirtin, gerade am Verschwinden nachdem sie abgeschlossen hatte. „C’est fermee“. Ein Zimmer haben wir dann doch noch bekommen, nichts zu Essen. Zurück in die Ferme Auberge, Küche zu.
estern Abend, kaum ausgeredet, da kam argumentative Unterstützung von oben. Donnergrollen im Rücken, erste Riesentropfen schlugen auf Helme, Arme und Oberschenkel. Das war sehr überzeugend für Bernhard, ich musste überhaupt nicht weiter in ihn dringen. Flucht in die Ferme 200 Meter weiter – aber kein freies Zimmer mehr. Dreihundert Meter weiter ein Hotel – geschlossen. Die Wirtin, gerade am Verschwinden nachdem sie abgeschlossen hatte. „C’est fermee“. Ein Zimmer haben wir dann doch noch bekommen, nichts zu Essen. Zurück in die Ferme Auberge, Küche zu.
Unsere Blicke mussten schon sehr verzweifelt betteln um noch eine Riesenterrine Fleisch und Kartoffeln, schwimmend in fetter Brühe, zu ergattern. Als Rest stand sie noch rum und musste nur noch aufgewärmt werden. Ansonsten Basta. Da darf ein Vegetarier nicht zimperlich sein.
Die Blitze auf der Passhöhe sorgten für Stromausfall und beim Essen im Schein der Stirnlampen mag sich das Eine oder andere Fetzelchen Fleisch dann auch schon mal in den falschen Magen verirrt haben. Der Regen hämmerte gegen die Fenster. Bier und Wein und Café und Essen und Wärme und ein Kuschelbett. Das Leben so herrlich. So schön, in den Betten zu liegen, während draußen die Elemente toben. So weit oben in den Bergen behütet und aufgehoben, über allem schwebend, und, ja, dem Göttlichen so nah. Geschlafen habe ich, wie ein Stein. Zumindest bis zum unerbittlichen Klingeln des Weckers um 3:45.
Verdammt, wir haben zu lang getrödelt heute Morgen. Na gut, dass wir das Tour de France Denkmal in der kalten Finsternis und den dichten Nebelschwaden nicht sofort gefunden haben, hat uns bestimmt noch mal zehn Minuten gekostet..
Gefahren sind wir, glaube ich, schnell. So genau lässt sich das alles nicht mehr sagen. Und Pausen hatten wir auch nicht viele. Nach dem reichhaltigen Frühstück  im Zimmer ohne Wasser mit abgestandenen Multivitaminsaft bzw. Malto-Wasser-Mischung aus Plastiktrinkflaschen, Baguette, Käse, Bonbons und Milchschnitten – na klar doch, alles vom Vortag - sind wir zackig gefahren und hatten nur noch eine essentielle Kaffeepause. Während einem morgendlichen, durch Nebelschwaden nässenden Guss, wir im Nebenraum einer Boulangerie bei den gehauchten Klängen einer Platte aus den Siebzigern. „Je táime…“, Zeitreisen in Zeitreisen. Zeit. Zeit vergeht. Wie viele Jahre hatten wir das nicht gehört?
im Zimmer ohne Wasser mit abgestandenen Multivitaminsaft bzw. Malto-Wasser-Mischung aus Plastiktrinkflaschen, Baguette, Käse, Bonbons und Milchschnitten – na klar doch, alles vom Vortag - sind wir zackig gefahren und hatten nur noch eine essentielle Kaffeepause. Während einem morgendlichen, durch Nebelschwaden nässenden Guss, wir im Nebenraum einer Boulangerie bei den gehauchten Klängen einer Platte aus den Siebzigern. „Je táime…“, Zeitreisen in Zeitreisen. Zeit. Zeit vergeht. Wie viele Jahre hatten wir das nicht gehört?
Erst bei der Auffahrt zum Petit Ballon fing ich dann mal an richtig zu rechnen und realisierte, dass wir zu spät dran waren, zumindest zu spät um als Randonneure zu finishen. Knapp über drei Stunden, fast 90 Kilometer zu fahren und dann kommt noch der sechs Kilometer lange Firstplan. Nach dem Firstplan noch mal Steigungen. Das war nicht zu schaffen, hatten wir doch schon viele Körner am Col du Page und dem mörderischen Grand Ballon verschossen, die wir fast übermütig hochgeflogen waren. Na, geflogen würde ich das nicht nennen. In jugendlichem Leichtsinn, in herrlicher Unbeschwertheit, weil wir uns so stark und unüberwindlich gefühlt hatten. Und weil alles wieder gut und trocken und herrlich und die Sonne kam und das Leben so schön und uns der Hafer gestochen hat.
Noch genau eine Stunde. Und wir sind noch nicht auf der Rheinbrücke. Noch ein Kreisverkehr und noch einer. Kein Anhalten, keine Cola. Rheinbrücke, noch 51 Minuten Zeit bis Martinstor. Bernhard vor mir stöhnt auf, ich weiß warum. Er sieht gerade, was ich auch ohne Navi weiß: Die Straße biegt im rechten Winkel ab – direkt nach Süden Über zwei Kilometer knallharter direkter Gegenwind, das Tempo ruckzuck auf 26 runter. Das geht nun gar nicht. Ich übernehme die Führung. Ich stöhne wieder. Zwei Kilometer bis Gündlingen. Alle Berichte über „Belchen satt“ habe ich gelesen. Berichtet wird vom Wiedener Eck, von Eptingen, vom Chilchzimmersattel, vom Weißenstein, von der Doubs-Schlucht, vom Servance. Die letzten fünhundert Meter bis Ortsschild Gündlingen, glaubt mir, lassen all dies verblassen. Gündlingen. Gündlingen wird massiv unterschätzt.
Schon der Firstplan war hart gewesen. Der Firstplan, keine 6% aber fast 6 Kilometer lang. Die Gruppe von sechzigjährigen überholte uns ohne uns eines Blickes zu würdigen, einer nach dem Anderen, und wir hatten dem nicht mehr viel entgegenzusetzen. Sechs Kilometer mit 12,13,14 km/h reißt uns den Schnitt gewaltig runter. Mehr war beim besten Willen aber nicht mehr drin. Gegenanstieg. Und noch einer.
Wir müssen die 30 Schnitt halten bis zum Martinstor. Kopfsteinpflaster in Gündlingen darf uns nun auch nicht bremsen. Gegenwind wird zu Seitenwind, ich bin platt, Bernhard übernimmt. Tempo, Heißa-Juchhe! Die Beine schreien auf vor Qual und Wollust. Ich stöhne. Kein Erbarmen. Versuch, nicht an Cola zu denken. Fahr. Fahr zu, Bernhard, Du hast keine Chance mehr, also nutze sie.
So unglaublich schön war es gewesen heute Morgen. Vogesen-Traum. Das Wetter ging auf, Luft, Höhenluft, so sauber und klar wie sie nach Gewittern sein kann. Nebelschwaden und Reste von Wolken hingen an Wäldern fest, zogen hierhin und dahin, strahlten in Sonnenflecken, lösten sich auf und gaben Blicke frei, Blicke auf malerische Dörfer unten in den Tälern und einsame, besonnte Höfe, die in den Höhen kleben wie Bienennester. In der Ferme auf dem Petit Ballon zu sitzen, über Allem, vor einem Bauernfrühstück, frische, selbstgemachte Butter, hauseigener Heidelbeermarmelade, dampfendem Cafe und jenem ganz jungen, zarten Münsterkäse, den es nur da oben gibt. Eier. Baguette. Einfach da sitzen und über den Rhein zum Schwarzwald schauen. Dann, wenn die Sonne höher steigt, ein kühler Rosé , das Glas ganz beschlagen. Ein Traum. Was hätte ich nicht alles dafür gegeben! Alles ! Nein, nicht die gelbe Karte. Ja, ich hatte es noch nicht einmal gewagt, kurz zu stoppen um meiner Liebsten einen Käse mitzubringen. Treten, Treten über Alles.
„Was ist denn das?“ Bernhard entsetzt, geschockt. Ortsende Merdingen, Kurve, Wand. Merdinger Buck. „Der letzte Pass, der könnte uns noch das Genick brechen“. „Oh Gott, nein!“ Das waren die letzten Worte zwischen uns.
Unglaublich, was der Körper immer und immer noch hergibt, bei der Abfahrt erholen wir uns schon wieder, Ortsmitte Umkirch, noch 17 Minuten. Baustelle. Mist, wenden. Auf dem kleinen Weg im Karacho über Höfe und mitten durch die Häuser. Ortsende und keine fünfzehn Minuten. Ich bin jetzt 49, schlagartig wird mir bewusst wie gnadenlos die Zeit verrinnt. Gnadenlos. So unerbittlich. Wir bäumen uns auf und rennen dagegen an, ein so hoffnungsloser, aussichtsloser Kampf. Einzig der unbändige Wille das Martinstor als Randonneur zu erreichen, ist ungebrochen, wider alle Vernunft, die einen Erfolg für unmöglich hält. Aber wir müssen gewinnen, und wenn es das letzte Mal ist, ein einziges Mal noch gewinnen. Monoton voranschreitende Zeit, Schweinehunde in Rage. Jetzt wird es richtig hart. Suchen nach Strohhalmen – vielleicht geht ja meine Uhr am Tacho etwas vor? Unwahrscheinlich, eher geht sie nach…
Dreisamradweg. Unerbittliche Steigungen aus dem nichts – vormals nie gesehen, Unterführung, Fußgänger, Kinderwagen, Unterführung, Jogger, Gegenverkehr. Tempo raus, Übersicht halten, Zwischensprint, Vernunft. Weiter. Ochsenbrücke. Kronenbrücke. Kaiserbrücke.
Kaiserbrücke. Fünfhundert Meter.
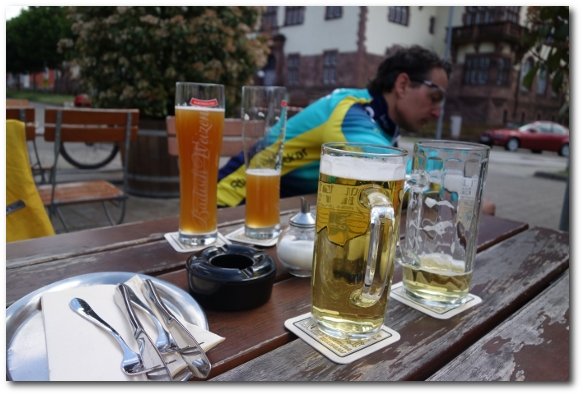 Ich kann die Uhr am Tor immer noch nicht sehen. Foto raus, Straßenseite wechseln. Endlich, ich sehe die Zeiger und glaube es nicht. Nein, das kann doch gar nicht sein.
Ich kann die Uhr am Tor immer noch nicht sehen. Foto raus, Straßenseite wechseln. Endlich, ich sehe die Zeiger und glaube es nicht. Nein, das kann doch gar nicht sein.
Zwei Minuten. Ganze zwei Minuten!
Wir schauen uns keuchend an. Sprachlos. Wir fassen es nicht.
Zwei Minuten.
Wir sind Randonneure
Wie hätten uns weitere drei Minuten denn verändern können!?









